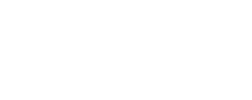Wer wagt, gewinnt
Wie die Angst vor Risiko unsere Zukunft gefährdet

TEXT Hannes Weinelt
Status-quo-Bias, Verlustaversion, Sozialstaat, Versicherungen, Überregulierung, Komfortzone, Helikoptereltern, Überbehütung: Das gute und bequeme Leben hat Europa in die Falle der Risikovermeidung geführt. Doch das neue Risiko heißt Sicherheit – und das in zweifacher Hinsicht.
IBM war Ende der 1960er einer der ersten globalen Konzerne mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern. Man dachte, Management sei universell, musste aber feststellen, dass viele Dinge in den USA funktionierten, in anderen Ländern jedoch nicht. Geert Hofstede war Psychologe bei IBM International und bekam die Aufgabe, die Ursachen dafür zu erforschen. Und seine Entdeckung war bahnbrechend und ist bis heute Standard im interkulturellen Management: Nationale Kultur hat einen stärkeren Einfluss auf Arbeitsverhalten als Unternehmenspolitik. Die Unterschiede beschrieb er in sechs Dimensionen. Darunter war der UAI, der Uncertainly Avoidance Index, zu Deutsch: Unsicherheits-Vermeidungs-Index. Länder mit einem hohen UAI streben nach Sicherheit, Stabilität, Planbarkeit. Länder mit einem niedrigen UAI sind risiko- und experimentierfreudiger. Es wird wohl niemanden überraschen, dass die Länder Europas größtenteils einen doppelt so hohen UAI aufweisen wie beispielsweise die USA. Und dies hat enorme Auswirkungen, vor allem in der heute sogenannten VUCA-Welt.
Was ist VUCA?
Mit VUCA bezeichnete das U. S. Army War College die neue geopolitische Situation nach dem Kalten Krieg Anfang der 1990er-Jahre. Das Ende des Ost-West-Konflikts löste die klaren Feindbilder und Vorhersagbarkeit der Weltordnung auf. Ab den 2000ern wurde der Begriff auch in Wirtschaft und Gesellschaft allgemein für eine Welt voller Unvorhersehbarkeit übernommen. VUCA ist ein Akronym für
- Volatility (Volatilität), die ständigen und immer schnelleren Veränderungen unserer Zeit.
- Uncertainty (Unsicherheit), wodurch traditionelle Gewissheiten zusammengebrochen sind.
- Complexity (Komplexität), sodass die Ursache-Wirkungs-Ketten nicht mehr erkennbar sind.
- Ambiguity (Mehrdeutigkeit), was keine fixen Zuordnungen von „Richtig-Falsch“ erlaubt.
Europa wurde von dieser neuen Realität am linken Fuß erwischt. Denn nach zwei Weltkriegen und der dazwischenliegenden Weltwirtschaftskrise mit all den Erfahrungen von Instabilität, Hunger und Tod wurde Sicherheit zum obersten Gebot. Starke Sozialstaaten wurden aufgebaut, eine Konsum- und Wohlstandsgesellschaft sollte alle materiellen Grundbedürfnisse abdecken und sozialen und politischen Frieden garantieren.
Die Europäische Union wurde genau auf dieser ökonomischen Basis begründet: Wer wirtschaftlich voneinander abhängig ist, bevorzugt sichere und stabile Verhältnisse und führt keinen Krieg. Doch in der VUCA-Welt mit ihren neuen Herausforderungen von Migration, geopolitischen Verschiebungen, Terrorismus, Klimakrise, Artensterben, Digitalisierung, Energiekrisen, Ressourcenkonflikten, Finanzkrisen, Inflation u. a. m. reicht eine reine Wirtschaftsunion nicht. Und dies wird umso deutlicher, wenn man sich mit einer möglichen Gegenstrategie von VUCA beschäftigt: VUCA-Prime.
Was ist VUCA-Prime?
Am Institute for the Future (IFTF) in Kalifornien entwickelte der Zukunftsforscher Bob Johansen eine konkrete Antwort auf jede VUCA-Komponente und nennt dies VUCA-Prime:
- Vision (Vision), denn klare und inspirierende Zukunftsbilder geben gerade in unsicheren Zeiten eine Richtung.
- Understanding (Verstehen), um Zusammenhänge und Muster zu erkennen, aber auch anzuerkennen, dass nicht alles vorhersehbar ist.
- Clarity (Klarheit), selbst wenn es nur die Klarheit über unsere Unwissenheit ist, schafft Handlungsfähigkeit, während das Verharren in der Komplexität das Entscheiden und Handeln lähmt.
- Agility (Anpassungsfähigkeit), damit wir rasch aus Fehlentwicklungen lernen und uns laufend und flexibel an neue Gegebenheiten anpassen.
Während die meisten europäischen Politiker gebetsmühlenartig Sicherheit und Stabilität wahlversprechen, um ihre Wähler vermeintlich „zurück in die gute alte Zeit“ zu führen, verspricht VUCA-Prime erst gar keine Sicherheit, sondern lehrt, wie man in unsicheren Zeiten und Situationen handlungsfähig bleibt. Dazu jedoch braucht es nach Johansen eine neue Qualität von Führungskräften. Eines seiner Bücher trägt den Titel: „Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World”. Selbst eine oberflächliche Prüfung dieser zehn Qualitäten macht klar, dass die politischen Eliten der EU über keine einzige davon verfügen. Zum Beispiel lautet die erste Qualität „Maker Instinct“, also die Zukunft aktiv zu gestalten, anstatt immer nur zu reagieren. Oder die Qualität des „Rapid Prototyping“, das heißt, Mut aus Fehlern zu lernen und rasch Neues auszuprobieren. Angesichts der überbordenden Bürokratie, der Schwerfälligkeit und des „Power Instinct“, also des Fokus auf Machterhalt der eigenen Person und Partei innerhalb der EU, erübrigt sich jeder Kommentar.
Natürlich sind neue Ideen rasch und leicht geschrieben, aber schwer und auch nur mit viel Geduld umsetzbar. Ich selbst prangere laufend die arrogante Selbstverständlichkeit von Schreibtischtätern – Berufsbezeichnung Journalisten – an, mit der sie Akteuren in Wirtschaft und Politik ihre Allheilmittel unter die Nase reiben. Aber eines ist und bleibt klar: Geänderte Umstände und Probleme verlangen geänderte Haltungen und Lösungen. In Europa wird die VUCA-Welt lieber klein geredet, anstatt große Visionen und Veränderungen in Angriff zu nehmen.
Genau die Sicherheit und Stabilität, die Europa nicht verlieren möchte und selbstmörderisch zu verteidigen sucht, genau die fehlende Bereitschaft zum Risiko ist das Risiko. Das erste Risiko. Das zweite liegt in uns, also in jedem Einzelnen.
„Wenn der Schüler nicht geht, wird der Weg zu ihm kommen.“
Zen-Weisheit
Risiko „Komfortzone“
Obwohl lange bekannt, wachsen täglich die Erkenntnisse über die fatalen Auswirkungen des Verharrens in der Komfortzone. Natürlich sind Angst und Stress auf ein Minimum reduziert, wenn man nur in seinen Routinen bleibt, nur bis zum Tellerrand seiner bekannten Fähigkeiten agiert und nur in seinen gewohnten Blasen denkt und spricht.
Aber die Neurowissenschaften zeigen auf, wie dadurch unser Gehirn schrumpft und die neuronale Plastizität verlorengeht. Wie sich dadurch die Angst vor Neuem mehr und mehr bis zur sogenannten „erlernten Hilflosigkeit“ verstärkt. Wie die Fähigkeit, Stress zu bewältigen, abnimmt und kleinste Störungen zu hoher Belastung führen. Wie die fehlende Herausforderung in Langeweile, Unzufriedenheit und letztlich Depression mündet. Wie durch einen bequemen Rückzug die sozialen Kompetenzen verlorengehen, wie durch laufende Unterforderung nicht nur Potenzial ungenutzt bleibt, sondern Leistungsfähigkeit sogar rapide abnimmt.
Wem das noch nicht genügt, um die Komfortzone als Schreckgespenst auf den finsteren Dachboden zu verbannen, dem seien noch die Auswirkungen auf unsere Erziehung und damit die nächste Generation aufgelistet. Denn Eltern, die sich selbst nach Komfortzonen sehnen, werden zu „Helikopter-Eltern“, die das Leben ihrer Kinder ständig überwachen und ihren Kindern alle Entscheidungen abnehmen. Und zu „Rasenmäher-Eltern“, die ihren Kindern alle Steine aus dem Weg räumen und jedes Hindernis planieren. Die Folgen sind geringe Frustrationstoleranz – schon kleinste Kränkungen können zu monströsen Amokläufen führen –, fehlende Problemlösungskompetenz und damit fehlendes Vertrauen in sich selbst, verstärkte Angst vor Risiko – heute traut man Gymnasiasten nicht einmal mehr den Schulweg zu –, vor allem aber eine eklatante Zunahme von Angststörungen, Burn-out und anderen psychischen Beeinträchtigungen. In den markanten Worten der Psychologin Esther Wojcicki: „Überbehütung ist Unterentwicklung“. Und sie muss es wissen, hat sie doch ihre drei Töchter zu höchst engagierten und erfolgreichen Menschen erzogen.
Fazit: „Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone!“ (Neale Donald Walsch, bekannt von den „Gesprächen mit Gott“) Wer also seine Komfortzone nicht verlässt, wer in der trügerischen Sicherheit verharrt und kein Risiko auf sich nimmt, hat tatsächlich eine Gewissheit: die Gewissheit, das Leben und seine eigene Entwicklung zu verpassen.
„Das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone.“
Neale Donald Walsch
Der „Sprung des Glaubens“
Haben Sie gewusst, dass dieses Zitat von Søren Kierkegaard stammt? Und hätten Sie gedacht, dass dieser Religions- und Existenzphilosoph als der Philosoph des Risikos gilt? Bei ihm ist Risiko nicht ökonomisch oder Mittel zum Zweck, sondern das Wesen der Existenz. Risiko ist der Preis von Freiheit und Selbstverwirklichung. „Wer wagt, der verliert vielleicht. Wer nicht wagt, der verliert gewiss“, lautet sein Credo. Dieses Wagnis, trotz Unsicherheit zu entscheiden und zu handeln, nennt Kierkegaard den „Sprung des Glaubens“. Damit meint er nicht nur den Akt des Glaubens in Gott ohne Sicherheiten und Beweise.
Der Sprung des Glaubens ist ein universelles Prinzip, wir alle müssen immer wieder ohne Sicher- und Gewissheiten entscheiden: Wir verlieben uns – haben wir die Sicherheit, dass diese Liebe für immer hält? Wir wechseln unseren Job. Wir ziehen in eine andere Stadt oder gar ein anderes Land. Wir gründen eine Familie. Wir starten ein neues Projekt. All diese existenziellen Entscheidungen beinhalten das Risiko von Verletzung, Trennung, Verlust, Scheitern und Enttäuschungen aller Art. Es sind keine sanften Übergänge, es sind Sprünge – vom Zweifel ins Vertrauen, von der Kontrolle in die Hingabe, von rational begründbaren Sicherheiten in das Glauben. „Der Glaube beginnt dort, wo das Denken aufhört“, schreibt Kierkegaard. Er war kein Gegner des Denkens, aber Denken hat seine Grenzen. So sehr wir auch prüfen und analysieren, es wird uns keine absolute Gewissheit liefern. Und an dieser Stelle müssen wir springen. Wir leben von und durch Entscheidungen, nicht von und durch Garantien.
Genauso deutlich formulieren es die östlichen Philosophien. Darin heißt es, dass Leiden durch die Anhaftung an Sicherheiten entsteht. Und sie fügen noch einen weiteren Gedanken dazu: Wer sich an Sicherheiten klammert und sich nicht freiwillig den Herausforderungen stellt, wird nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung (Karma) dazu gezwungen. „Wenn der Schüler nicht geht, wird der Weg zu ihm kommen“, sagen die Zen-Meister. Im Taoismus heißt es: „Wer sich dem Wandel widersetzt, wird vom Wandel überwältigt.“
„Wandel“ ist wohl das treffendste Konzept für unsere aktuelle Situation in der Welt. Kollektiv ist es längst ein Wandel, der uns überwältigt: Geopolitische und wirtschaftliche Kriege, KI und Digitalisierung, Extremwetter, Migrationsbewegungen. Individuell liegt es an jedem von uns. Im Kleinen ist jeder Tag eine Gelegenheit, unsere Komfortzone zu verlassen und etwas Unbekanntes zu wagen: Ein Gespräch mit einer fremden Person beginnen, einen neuen Weg zu unserem Arbeitsplatz ausprobieren, ein unangenehmes Problem ansprechen oder eine Entschuldigung aussprechen. Im Großen müssen wir uns ehrlich fragen, wo wir uns zwar sicher fühlen, aber gleichzeitig das Leben und Wachstum verpassen: der sichere Job, der nur noch Routine und keine Weiterentwicklung ermöglicht; der langjährige Freundeskreis, der längst nicht mehr unseren Interessen entspricht; die immer gleichen Konflikte, ohne dass wir die Probleme ehrlich ansprechen oder die halbherzige Beziehung, weil uns die Einsamkeit ängstigt.
Bevor Sie vom Wandel überwältigt werden, wagen Sie den „Sprung des Glaubens“.
Hat dir dieser Artikel gefallen?
Bestelle diese Ausgabe oder abonniere ein Abo. Viel Inspiration und Freude beim Lesen.